Insektenvielfalt
Die Insektenbiodiversität nimmt aufgrund von Lebensraumverlust, Klimawandel, Pestiziden und intensiver Landwirtschaft rapide ab, wodurch Ökosysteme und Nahrungsnetze gestört werden. Überwachung und Aufklärung der Öffentlichkeit sind entscheidend für den Schutz dieser wichtigen Arten.
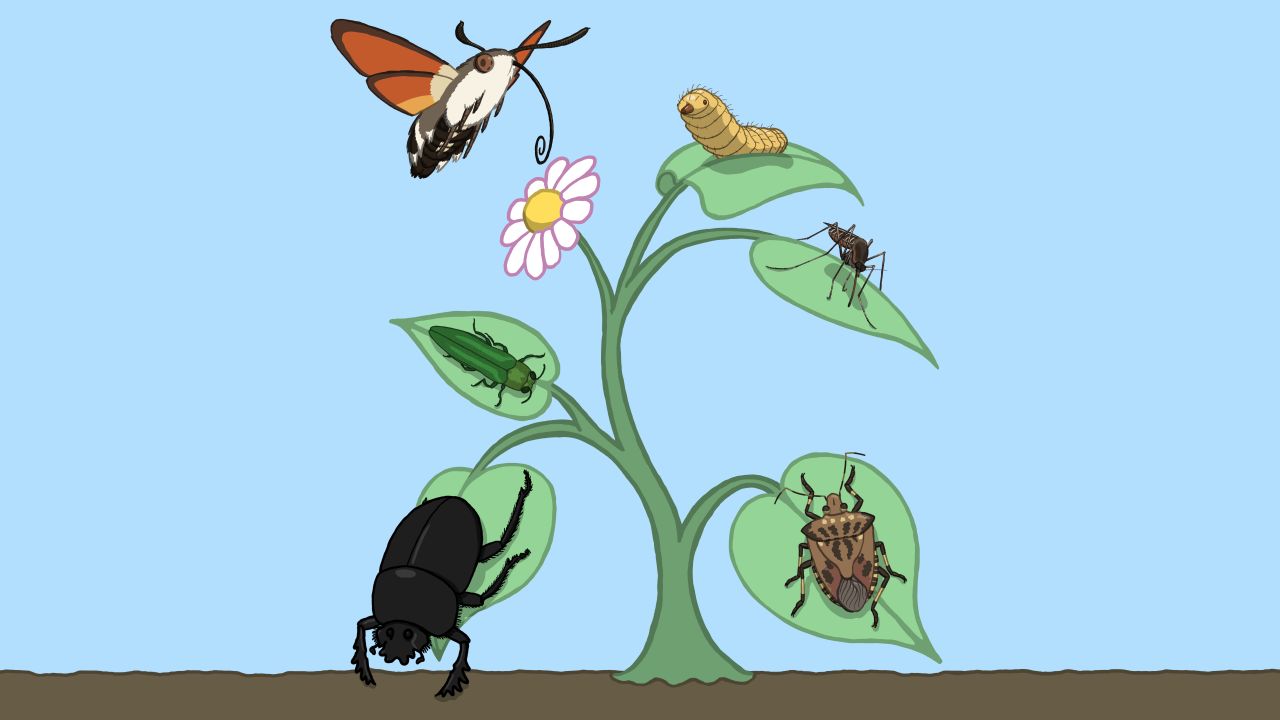
Eine Collage aus Insektenzeichnungen, die die faszinierende Vielfalt der Insekten symbolisiert. Bild: © Martin Breu
In den letzten Jahrzehnten wurde in vielen Ländern ein alarmierender Rückgang der Artenvielfalt und Verbreitung von Insekten beobachtet. Neue Studien zeigen zudem, dass selbst sehr häufige Arten hinsichtlich ihrer Verbreitung, Häufigkeit und Biomasse rapide abnehmen.
In der Schweiz zeigt der Bericht „Insektenvielfalt in der Schweiz“ der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) den anhaltenden Rückgang der Insektenvielfalt auf. Der Bericht stellt ausserdem 12 konkrete Massnahmen vor, um die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Insektenpopulationen zu verringern – zum Beispiel durch den reduzierten Einsatz von Pestiziden, die Eindämmung des Klimawandels und die Minimierung von Lichtverschmutzung.
1- Insektenhotspots identifizieren und erhalten
2- Lebensräume aufwerten, vernetzen und neu schaffen
3- Gezielte Artenförderungsmassnahmen umsetzen
4- Risiken und Einsatz von Pestiziden minimieren
5- Stickstoff- und Phosphoreinträge reduzieren
6- Bewirtschaftung insektenfreundlich gestalten
7- Klimawandel abwenden
8- Lichtverschmutzung reduzieren
9- Monitoring und Erfolgskontrollen ausbauen
10- Forschung intensivieren
11- Artenkenntnisse und Handlungskompetenzen verbessern
12- Die grossen Hebel angehen (Politik und Wirtschaft nachhaltig transformieren)
Wenn die Insekten verschwinden, verlieren wir auch die Vögel. In ländlichen Gebieten beobachteten Forschende 60 % weniger Vögel, die sich von Insekten ernähren.

Ein Wiedehopf mit einer Käferlarve im Schnabel. Bild: © Kaan Mika
Überwachung ist entscheidend
Um zu beurteilen, ob eine Insektenart gefährdet ist, ist sorgfältiges Monitoring unerlässlich. Forschende setzen verschiedene Methoden ein, um Artenvielfalt und Biomasse an unterschiedlichen Standorten zu erfassen. Zu den traditionellen Techniken gehören Bodenfallen, Kescher, Lichtfallen und Klebfallen – damit werden repräsentative Poben von Insektenpopulationen gesammelt. Diese werden anschliessend bestimmt, gemessen und katalogisiert, um Erkenntnisse über Bestandsentwicklungen und Verbreitungsmuster zu gewinnen.

Eine Malaisefalle zum Fang fliegender Insekten. Bild: Wikimedia Commons/Ceuthophilus, CC License
Auch Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (Citizen Scientists) leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfassung der Insektenvielfalt, indem sie Daten zur Verbreitung und Gesamtzahl von Arten beisteuern. Im Rahmen verschiedener Programme und Initiativen können Einzelpersonen bei der Beobachtung von Insekten in ihrer lokalen Umgebung mithelfen. Durch die Übermittlung von Sichtungen, Fotos und anderen relevanten Informationen helfen Citizen Scientists den Forschenden, Trends bei Insektenpopulationen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Durch diese Zusammenarbeit wird die Reichweite der Überwachung der biologischen Vielfalt vergrössert, insbesondere bei Arten, die sich nur schwer eingehend untersuchen lassen. Unser Artikel über Glühwürmchen verdeutlicht beispielsweise, wie wichtig gemeinschaftsbasierte Daten für das Verständnis des Status dieser ikonischen Insekten und ihrer Lebensräume sind.
Ein weiteres, hochwirksames Verfahren ist der Einsatz von Umwelt-DNA – diese Methode erfordert viel Fachwissen, ermöglicht aber die Erfassung schwer nachweisbarer Insektenarten.
Für seltenere Arten ist die Rote Liste – zusammengestellt von Expertengremien – von grosser Bedeutung. Sie bewertet das Aussterberisiko und hilft, besonders schutzbedürftige Arten zu identifizieren. Zudem ist sie ein Indikator für den Zustand von Ökosystemen: Sinkende Insektenzahlen deuten auf umfassendere Umweltprobleme hin. Die Liste unterstützt gezielte Schutzmassnahmen und hilft, Ressourcen für besonders gefährdete Arten zu priorisieren.
Schon gewusst?
Das „Windschutzscheiben-Phänomen“ beschreibt den Rückgang der Anzahl toter Insekten auf Windschutzscheiben und Stossstangen – eine Beobachtung, die inzwischen durch wissenschaftliche Daten gestützt wird. So dokumentierte eine dänische Studie über 20 Jahre hinweg den Insektenrückgang auf derselben Strassenstrecke. Sie kam zu dem Schluss, dass der Rückgang der Insekten auf Windschutzscheiben in erster Linie auf einen allgemeinen Rückgang der lokalen Insektenpopulationen zurückzuführen ist. Dieses Ergebnis stimmt mit regionalen Studien zur Insektenüberwachung überein und untermauert den Zusammenhang zwischen der geringeren Insektenbiomasse und dem beobachteten Rückgang der Insektensterblichkeit am Strassenrand.
Totholz gibt Leben
Totholz ist ein essenzieller Bestandteil von Waldökosystemen und trägt massgeblich zur Insektenvielfalt bei. Ein einzelner toter Baum kann Hunderte Arten beherbergen – darunter Käfer, Pilze, Milben und viele mehr – alle in einem komplexen Geflecht miteinander verbunden. Beim Verrotten dient das Holz als Nahrung, Unterschlupf und Brutstätte für zahlreiche saproxyle (totholzbewohnende) Arten. Zum Beispiel legen Bockkäfer (Cerambycidae) und Borkenkäfer (Scolytinae) ihre Eier unter die Rinde abgestorbener Bäume, wo sich die Larven vom zersetzenden Holz ernähren. Diese Käfer wiederum locken Räuber und Parasiten an – so entsteht ein mehrschichtiges Nahrungsnetz, das vollständig auf Totholz angewiesen ist.

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) ist auf Totholz angewiesen und wird in der Roten Liste der IUCN als potenziell gefährdet geführt. Bild: Wikimedia Commons/Bugman95, CC License
In gemässigten und borealen Wäldern sind viele Insektenarten in mindestens einer Lebensphase auf Totholz angewiesen – etwa der Hirschkäfer (Lucanus cervus), der seltene Eremit (Osmoderma eremita) oder bestimmte Schwebfliegenarten. Sie benötigen hohle Baumstämme, Baumstümpfe oder verrottende Äste. Diese Mikrohabitate sind unersetzlich, und ihr Verlust, durch übermässige Bewirtschaftung oder das Entfernen von Totholz, gefährdet spezialisierte Insektenarten stark. Auch wenn Totholz tot erscheint, steckt es voller Leben – und ist entscheidend für die Gesundheit des Waldes.
Licht aus
Künstliches Licht bei Nacht (Artificial Light at Night, ALAN) ist eine wachsende Bedrohung für Biodiversität und natürliche Prozesse. Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass es zur Abnahme von Insektenpopulationen beiträgt. Künstliches Licht verwirrt Insekten, da es ihre zeitliche und räumliche Orientierung stört, wichtige Umweltsignale maskiert und zu einer schädlichen Anziehung an Lichtquellen führt.
Nachtbeleuchtung beeinflusst das natürliche Verhalten von Insekten in vielen Lebensphasen negativ – sie stört ihre Aktivität, erhöht das Risiko gefressen zu werden, verringert die Eiablage und beeinträchtigt die Fortpflanzung.
Fünf Tipps für insektenfreundliche Aussenbeleuchtung
- Verwenden Sie nachts nur dann Licht, wenn es notwendig ist.
- Richten Sie die Beleuchtung gezielt aus, um ihre Wirkung auf die Umgebung zu verringern.
- Dimmen Sie das Licht, damit es keine Insekten aus der Ferne anlockt.
- Verwenden Sie Bewegungsmelder, um Energie zu sparen und zu vermeiden, dass die Tiere zu lange dem Licht ausgesetzt sind.
- Schalten Sie auf Licht mit niedriger Wellenlänge (viele Insekten können rotes Licht nicht sehen) anstelle von UV- oder blauem Licht.
Mehr Infos zur insektenfreundlichen Beleuchtung gibt es auf der Website von DarkSky International.
Dieses Thema beleuchtet den Rückgang der Insektenvielfalt, Methoden zur Erfassung sowie Strategien zum Schutz dieser essenziellen – und gleichzeitig empfindlichen – Tierarten.
Quellen
Widmer I et al. 2021. La diversité des insectes en Suisse : importance, tendances, possibilités d'action. Swiss Academies Reports 16;9. doi.org/10.5281/zenodo.5144800
Hallmann CA et al. 2021. Insect biomass decline scaled to species diversity: General patterns derived from a hoverfly community. Biological sciences 118;2:e2002554117. https://doi.org/10.1073/pnas.200255411
Hallmann CA et al. 2017. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS one 10.1371/journal.pone.0185809
Møller AP 2019. Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over 22 years. Ecology and evolution 9;11:6581-6587. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.5236
Keystone-SDA/jc. Swiss scientists call for action on disappearing insects https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/biodiversity_swiss-scientists-call-for-action-on-disappearing-insects/44895310 Stand 9.4.2025
